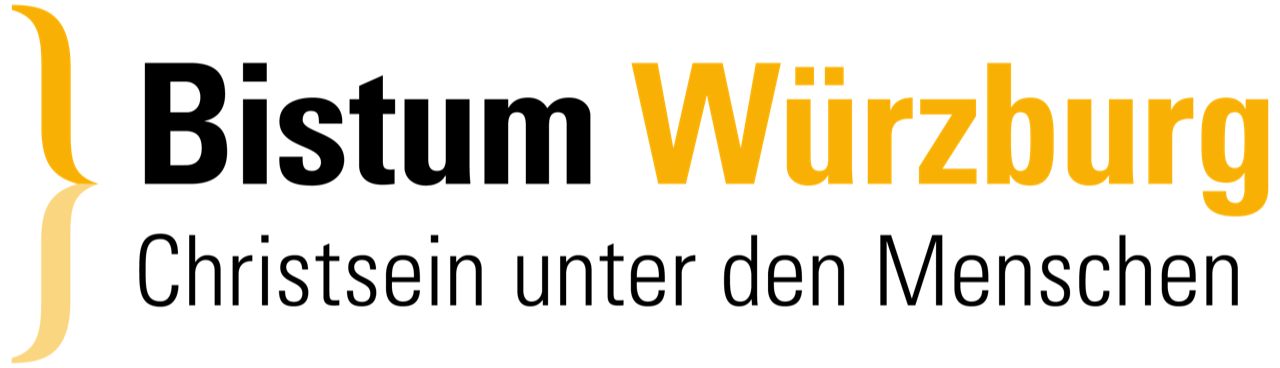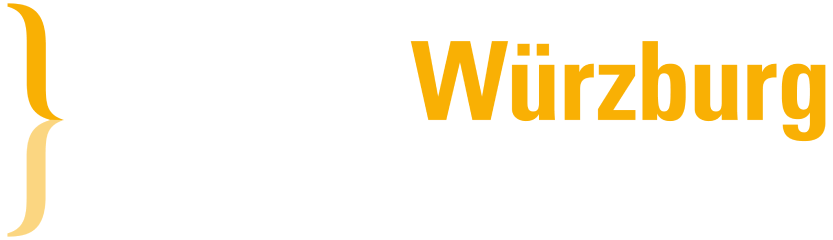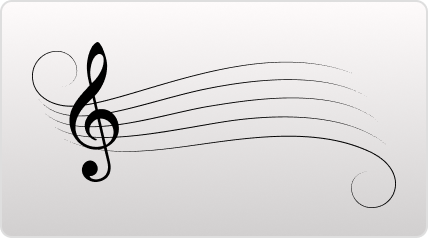Audioguides
rund um die St.-Laurentius-Kirche in Marktheidenfeld
Die Kirche St. Laurentius in Marktheidenfeld
(1. Playlist)
Herzlich willkommen in der Kirche St. Laurentius in Marktheidenfeld. Die katholische Kirchengemeinde freut sich, Sie hier begrüßen zu dürfen. In den nächsten Minuten möchten wir Sie bei Ihrem Besuch unseres Gotteshauses begleiten. An zehn Stationen erwarten Sie kurze Audio-Dateien, die Ihnen den Kirchenbau von außen und innen näherbringen. Dabei erhalten Sie sowohl Informationen zur Baugeschichte als auch zur religiösen Symbolik. Sie entscheiden selbst, wie viel Zeit Sie sich nehmen möchten – jede Station steht für sich, sodass Sie auch gerne einzelne Punkte überspringen können. Die Audio-Dateien stehen Ihnen auch als Text zum Nachlesen auf der Homepage zur Verfügung. Zusätzlich gibt es noch eine zweite Playlist, die Ihnen die Heiligenfiguren an den Pfeilern im Mittelschiff und an den Seitenaltären erklärt. Dazu folgen später weitere Hinweise.
Es ist schön, dass Sie hier sind - Ein Besuch unserer Kirche lohnt sich: Denn die Kirche St. Laurentius ist ein echtes Wahrzeichen unserer Stadt. Viele Besucherinnen und Besucher kehren beispielsweise freitags nach einem Bummel über den Grünen Markt hier ein, um zur Ruhe zu kommen. Für unsere Gemeinde ist sie seit mehreren hundert Jahren geistliche Heimat – ein Ort der Begegnung, des Glaubens und der Stille. Und sie ist Namensgeberin für das größte Volksfest der Stadt: die Lauenzi-Messe im August. Zu Beginn des Audio-Guides ist es deshalb noch gut zu wissen, dass der Heilige Laurentius oft mit einem Rost in der Hand dargestellt wird. Unser Audio-Guide startet draußen an der Obertorstraße vor dem großen Hauptportal der Kirche. Gehen Sie nun dorthin.
Sie stehen vor dem Hauptportal der Kirche und blicken auf die barocke Westfassade von 1736. Oben entdecken sie drei Sandsteinfiguren aus dem 19. Jahrhundert: Laurentius in der Mitte, Josef zur Linken und Maria zur Rechten. Laurentius ist ein zweites Mal direkt über der Eingangstür dargestellt.
Wenn sie wenige Schritte nach rechts gehen, sehen sie den Kirchturm mit der Uhr und dem Hahn auf der Spitze. Die Dachform gleicht einer Birne. Ursprünglich ragte die markante Echterkirchturmspitze in den Himmel, die 1805 einem Brand zum Opfer fiel. Die Laurentiuskirche wurde nämlich unter dem Würzburger Fürstbischof Julius Echter 1613 / 14 errichtet. In der Zeit der Gegenreformation sollte man schon von weitem erkennen, dass Marktheidenfeld wieder katholisch ist.
Gehen Sie nun alle Treppen bis zum Glas-Vordach am Kirchturm hinauf. Bis Sie dort angekommen sind, hören Sie Musik. Danach wird die Führung fortgesetzt.
Sie stehen nun vor zwei Türen. Die rechte Türe führt in die heutige Sakristei, die der früheren Wehrkirche aus dem 12. Jahrhundert als Chorraum diente. Die darin wiederentdeckten mittelalterlichen Fresken aus dem 15. Jahrhundert, mit Christus als Weltenherrscher in der Apsis und den Symbolen für die Evangelisten am Deckengewölbe, stellen die ältesten Bildmotive dar. Da die Sakristei nicht besichtigt werden kann, können sie sich auf der Homepage ein Bild davon machen.
Drehen Sie sich jetzt um und schauen Sie auf die schräg gegenüber liegende Kreuzigungsgruppe. Sie steht auf dem Kalvarienberg, dem ehemaligen Friedhof, laut Inschrift am 30. April 1675 von Stephan Decker und seiner Frau Margaretha gestiftet. Jesus am Kreuz, seine Mutter Maria links und sein Lieblingsjünger Johannes rechts. Das Gebet auf der Inschriftentafel ist ein Zeugnis der damaligen Frömmigkeit.
„O Jesu mein Hilf und mein Gewinn
zu dir mein Herz und alle Sinn
mein Arbeit du segnest mit deiner Gnad
dafür ich dank dir Frühe und Spath.
Jesu mein Trost und Zuversicht
von dir lasse nimmer scheiden mich
dein Kreuz, dein Leiden und bitter Tod
sind mir ein Trost in aller Not.“
Gehen Sie nun geradeaus in Richtung Kirchgasse weiter. Dabei erblicken sie an der Kirchenwand vier Tafeln, die an das segensreiche Wirken der Ordensschwestern in Marktheidenfeld erinnern.
1856 – 1984 die Armen Schulschwestern
1885 – 1989 die Würzburger Erlöserschwestern im Krankenhaus
1924 – 1983 die Würzburger Erlöserschwestern im ambulanten Pflegedienst
1984 – 2006 die Missionsschwestern vom Heiligsten Herzen Jesu von Hiltrup
Nach der Weinlaube können Sie zur Rechten ein Relief des Erzengels Michael von 1749 in Augenschein nehmen: Die lateinische Inschrift Quis ut Deus = „Wer ist wie Gott?“ deutet den Namen Michael, der das Böse unter seinen Füßen, den gefallenen Engel Luzifer, besiegt hat. Er wird auch als Schutzherr der Friedhöfe angesehen.
Nach der Außenbesichtigung der Laurentiuskirche wartet die Innenbesichtigung auf Sie. Dafür kehren Sie bitte zum Hauptportal an die Obertorstraße zurück. Auf dem Weg dorthin hören sie wieder Musik.
Wenn Sie die Eingangstüre öffnen, führen wenige Stufen hinauf. Sie lassen gleichsam die Niederungen des Alltags hinter sich und treten ein in das Haus Gottes, einem heiligen Ort. Die beiden Weihwasserkessel an den Bänken laden Katholiken dazu ein, sich mit Weihwasser zu bekreuzigen, als Erinnerung an die eigene Taufe. Nehmen Sie danach in den Bänken des Mittelschiffes Platz.
Die Sakristei
Suchen Sie sich einen Platz in den Kirchenbänken des Mittelschiffes: Setzen Sie sich hin: Von hier aus haben Sie einen guten Überblick über den gesamten Raum. Schauen Sie sich in Ruhe um, lassen Sie ihren Blick zur Decke und zu den Seiten schweifen. Sie werden feststellen, dass die St. Laurentius-Kirche eine ganz besondere Atmosphäre ausstrahlt. Die Kirche wurde zuletzt im Jahr 2020 renoviert und erstrahlt heute in neuem Glanz. Die Bänke in den Seitenschiffen wurden im Zuge der Renovierung entfernt und durch Stühle ersetzt.
Außerdem kehrte im Jahre 2020 der Taufstein wieder zurück in die Kirche. Diese Renovierungsarbeiten zeigen, dass St. Laurentius kein Museum ist – hier wird noch heute gebetet, gelebt und Glauben erfahren. Nicht nur in den vergangenen Jahren, sondern bereits seit über 700 Jahren wird an der Marktheidenfelder Kirche immer wieder gebaut: Die größte Umgestaltung erfuhr die Kirche Anfang des 17. Jahrhunderts durch Fürstbischof Julius Echter. Den Gedenkstein des Erbauers können Sie später betrachten. Geweiht wurde die Kirche nach den Umbauarbeiten schließlich am 8. September 1614 durch den Würzburger Weihbischof Eucharius Sang. Diese Umgestaltung stand auch in Zusammenhang mit der Gegenreformation: Nach mehreren Jahrzehnten ist Marktheidenfeld wieder katholisch geworden. Auch in der Folgezeit wurde die Laurentius-Kirche mehrfach umgestaltet:
1736 erfolgte mit der Orgelempore und der barocken Schaufassade die erste Erweiterung. 1737 entstand der neue Hochaltar. Um die beiden Längsschiffe wurde die Kirche schließlich im Jahre 1898 vergrößert. Wichtig ist dabei zu wissen, dass es schon vor 1600 einen kleinen Kirchenbau im damaligen Fischerort „Heidenfeld“ gegeben hat. Dazu erfahren Sie an der nächsten Station noch mehr. Blicken Sie jetzt einmal zur Kirchendecke: Über Ihnen können Sie eine beeindruckende Stuckarbeit aus dem späten 19. Jahrhundert bewundern. Diese kunstvolle Darstellung zeigt Marias Aufnahme in den Himmel. Das Fest „Maria Himmelfahrt“ wird jedes Jahr am 15. August gefeiert. Ein alter Brauch dabei ist das Segnen von Kräutern.
Schauen Sie nun auf die beidseitigen Pfeilerbögen des Mittelschiffes.
Dort sind weitere Stuckarbeiten zu bewundern, welche die vier Evangelisten darstellen: Rechts zu sehen sind: Matthäus als Mensch sowie Markus als Löwe. Links abgebildet sind: Lukas als Stier und Johannes als Adler. Diese vier Männer haben in der Bibel über das Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu Christi geschrieben. Wir setzen die Führung am Taufstein fort. Diesen finden Sie im hinteren rechten Seitenschiff.
Der alte Taufstein wurde bei der letzten Renovierung 2020 wieder in die Kirche integriert. Am Taufstein werden vor allem Kinder getauft, um mit Hilfe ihrer Eltern und Paten in den christlichen Glauben hineinzuwachsen. Die Osterkerze weist auf ihr neues Leben mit Jesus Christus hin, der uns von aller Schuld und Sünde erlöst und den Tod besiegt hat. Er schenkt uns am Lebensende das ewige Leben bei Gott und führt uns von der irdischen Dunkelheit ins himmlische Licht. In der Osterzeit finden sie die Osterkerze vorne im Altarraum.
An der Hinterwand steht der Beichtstuhl, der Mitte des 18. Jahrhunderts aus Holz gefertigt wurde. Die Beichte zählt neben der Taufe zu den sieben Sakramenten der katholischen Kirche.
Oberhalb des Beichtstuhles leuchtet ein buntes Glasfenster: Diakon Laurentius ist für die Armen und Kranken, für die Kinder und Alten da. Diese hilfsbedürftigen Menschen sind für ihn der wahre Schatz der Kirche. Er teilt ihnen das Laurentiusbrot aus.
Eine Besonderheit stellen die beiden Grabplatten rechts neben dem Beichtstuhl dar: Diese wurden bei Renovierungsarbeiten im Jahre 2003 unter dem Fußboden der Sakristei wiederentdeckt und zeigen das katholische Grafenehepaar Wilhelm und Elisabeth von Krichingen, das über Marktheidenfeld herrschte und 1610 bzw. 1612 verstarb. Ihre Gesichter wurden während einer kurzen protestantischen Phase im Zuge des 30-jährigen Krieges weggeschlagen. Die Konfessionskriege lassen grüßen.
Direkt über den Grabplatten befindet sich eine wichtige Gedenktafel aus dem Jahre 1613. Die lateinische Abkürzung D.O.M. steht für Deo Optimo Maximo: „Gott gewidmet, dem besten und Größten.“ Der Text lautet:
„Bischoff Julius auß Vatters Treuw,
Dottirt die Pfarr Baut die Kirchen Neuw,
Pflantzt ein die Alt Religion.
Deß Volgt Im sein Treuw Unterthan,
Er freudt sich deß und Wünscht darbey,
Daß Gott diß Wecks ein Schützer sey
Dafür er Nur den danck begehrth,
Daß sein Vorsorg bleib Unverkehrt.“
Dieser Wunsch ist für Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn in Erfüllung gegangen: Mit über dreihundert Kirchenneubauten hat er den Katholizismus in seinem Bistum Würzburg zu neuer Blüte geführt. Er selbst ist 1617 gestorben.
Gehen Sie nun zum rechten Seitenaltar, dem Marienaltar. Dort wird unsere Führung fortgesetzt.
Sie stehen nun vor dem Seitenaltar, der Maria, der Mutter Gottes, gewidmet ist. Dieser Altar – ebenso wie sein Pendant auf der gegenüberliegenden Seite – wurde ursprünglich in den Jahren 1692/93 von Schreinermeister Caspar Bretträger aus Lengfurt gefertigt. Die Altäre haben eine bewegte Geschichte, da sie im Laufe der Jahrhunderte mehrfach restauriert und umgewidmet wurden. Von 1879 bis 1930 war beispielsweise an jedem Altar ein eigener Tabernakel vorhanden, während man die großen Gemälde durch Figuren ersetzte. Heute sehen Sie im Zentrum des rechten Seitenaltares wieder das barocke Ölgemälde nach Lukas Cranach, das um das Jahr 1700 für diesen Altar angefertigt wurde. Dargestellt ist das Jesuskind mit der Gottesmutter Maria. Ein besonderes Detail dieses Bildes sind die zwei Engel, die Maria einen Kranz aus Rosen auf das Haupt setzen. Diese Geste kann als Krönung zur Himmelskönigin gedeutet werden. Gleichzeitig erinnert sie an das Rosenkranzgebet, das Maria seit Jahrhunderten in Liebe gewidmet wird. Unter dem Gemälde befindet sich eine Pietà aus dem Jahre 1894 von Franz Wilhelm Driesler aus Lohr: Maria hält ihren verstorbenen Sohn Jesus in den Armen – ein ergreifendes Bild des Leidens und der Liebe. Gerade Menschen in schwierigen Lebenssituationen fühlen sich hier verstanden und angenommen. Viele Gläubige entzünden vor dieser Darstellung eine Kerze, verweilen im stillen Gebet und vertrauen Maria ihre Sorgen, ihren Dank oder ihre Bitte an. Als Fürsprecherin bei Gott gilt Maria als eine, die mitfühlt und Hoffnung schenkt.
Vielleicht möchten auch Sie bei Maria eine Kerze entzünden?
Hier sehen sie außerdem die heilige Barbara, den heiligen Wendelin und den Jesusknaben. Informationen dazu sind in der zweiten Playlist nachzuhören.
Unsere Führung geht nun vor dem Altarraum weiter. Begeben Sie sich dazu vor die erste Bankreihe.
Der Altarraum, auch Chor genannt, ist nach Osten ausgerichtet. So wie die Sonne im Osten aufgeht, steht Jesus Christus als Sonne der Gerechtigkeit im Mittelpunkt des Gottesdienstes. An der Chorbogenwand gibt der von Engeln gehaltene Vorhang, um 1898 als Stuckrelief geschaffen, das Programm vor:
Vorhang auf für das heilige Spiel, das wir im Gottesdienst mit Zeichen, Symbolen und Bildern feierlich inszenieren.
Mit den Gaben von Brot und Wein feiern wir den Tod und die Auferstehung Jesu Christi auf dem Tisch des Herrn und erwarten seine Wiederkunft. Es ist die Eucharistiefeier, die große Danksagung der Kirche, Quelle und Höhepunkt unseres Glaubens. Der fränkische Künstler Max Walter hat den Altar aus rotem Sandstein 1983 geschaffen. Altar leitet sich vom lateinischen Wort altus ab und bedeutet soviel wie hoch, erhaben. Der Altar als Mittelpunkt und Zeichen für Christus selbst soll deutlich in der Kirche sichtbar sein.
Im Altar sind Reliquien des heiligen Laurentius, der Heiligen Fausta und Eugenius, des ersten Bischofs von Würzburg Burkard sowie des seligen Diözesanpriesters Liborius Wagner eingebaut.
Der steinerne Ambo links neben dem Altar ist ebenfalls ein Werk von Max Walter. Ambo kommt aus dem Griechischen anabainein und bedeutet hinaufsteigen: Die Gemeinde soll das Wort Gottes gut sehen und hören können. Das Evangeliar liegt nach dem Gottesdienst aufgeschlagen neben dem Ambo: Gottes Wort ist offen für alle Menschen.
Die drei Sandsteinsitze, auch Sedilien genannt, sind rechts vom Altar, wie Ambo und Altar, fest im Boden eingelassen. Der mittlere Sitz ist für die Leitung der Liturgie reserviert. Die Ministrantinnen und Ministranten sitzen daneben.
Am prunkvollen barocken Hochaltar, 1737 entstanden, wurde früher die Heilige Messe gefeiert. Schreinermeister Johann Caspar Balling hat den zweisäuligen Aufbau angefertigt. Im vergoldeten Tabernakel werden die gewandelten Hostien aufbewahrt, z.B. für die Krankenkommunion.
Die lateinische Aufschrift Ecce Agnus Dei aus dem Johannesevangelium, zu Deutsch „Seht das Lamm Gottes“, ist ein Bild für Christus, der geduldig wie ein Lamm die Schuld der Menschheit getragen hat. Der Tabernakel wurde erst 1904 von den Bildhauern Matthäus und Heinz Schiestl aus Würzburg gefertigt. Tabernakel, aus dem Lateinischen tabernaculum abgeleitet, kann man mit „kleines Zelt“ übersetzen. Gott ist mit uns unterwegs und schlägt sein Zelt unter den Menschen auf.
Der dargestellte Pelikan steht für die antike Vorstellung, dass er mit dem eigenen Blut seine Jungen ernährt, was symbolisch auf den Erlösertod Jesu übertragen wurde.
Das große Altarbild zeigt das Martyrium des Heiligen Laurentius. Es wurde 1737 von Georg Sebastian Urlaub aus Thüngersheim bei Würzburg gemalt.
Die Statuen der beiden Apostelfürsten Petrus und Paulus verdanken sich dem flämischen Hofbildhauer Jacob von der Auwera aus Würzburg. Petrus mit dem Schlüssel in der Hand nimmt Bezug auf das Matthäusevangelium, wo Jesus zu Petrus sagt: „Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches übergeben.“
Paulus mit dem Schwert erinnert an seinen Tod: als römischer Bürger durfte er nicht gekreuzigt werden, sondern wurde mit dem Schwert enthauptet.
Den krönenden Abschluss des Hochaltares bildet die Heilige Dreifaltigkeit: Gott Vater, sein Sohn Jesus und der Heilige Geist in Gestalt einer Taube, die im Himmel thronen. Umgeben ist die Dreifaltigkeit von den himmlischen Engeln, die mit den beiden Engeln am Tabernakel korrespondieren: In der Heiligen Messe verbinden sich sozusagen Himmel und Erde.
Das Thema der Dreifaltigkeit wird nochmals in den Stuckreliefarbeiten an der südlichen und nördlichen Chorbogenwand durch die Heiliggeisttaube und dem Auge Gottes in einem Wolken- und Strahlenkranz aufgegriffen.
Die Ewig-Licht-Ampel aus dem 19. Jahrhundert, die Tag und Nacht brennt und rot leuchtet, weist auf die Gegenwart Jesu im Tabernakel hin. Ursprünglich leuchtete dieses Licht für die Verstorbenen auf dem angrenzenden Kirchfriedhof.
Links davon, an der nördlichen Chorwand, entdeckt man das mit goldenen Gittern verzierte Sakramentshäuschen aus Sandstein, um 1617 datiert, das in seiner gotischen Form eine Einheit mit den höhergelegenen Fenstern bildet. Es diente früher zur Aufbewahrung der heiligen Kommunion.
Darüber sehen sie ein großes Kruzifix aus dem 18. Jahrhundert, das zentrale Symbol unseres christlichen Glaubens.
Gegenüber, an der südlichen Chorwand, steht der schöne Rokoko-Kredenztisch, auf dem die Gaben von Brot und Wein für die heilige Messe bereitgestellt werden.
Über der Sakristeitür hängt das Bild Mariä Verkündigung aus dem 18. Jahrhundert: Der Erzengel Gabriel überbringt Maria die frohe Botschaft, dass sie die Mutter Jesu werden soll und sie willigt aus vollem Herzen ein.
Gehen Sie nun zum linken Seitenaltar, um mit der Audio-Führung weiterzumachen.
Sie stehen nun vor dem zweiten Seitenaltar und sehen hier die Darstellung Jesu auf dem Ölberg, einen entscheidenden Moment vor seinem Leiden. Dieser Altar wurde - wie der Marienaltar auf der rechten Seite - ebenfalls Ende des 17. Jahrhunderts angefertigt. Das Gemälde stammt ursprünglich auch aus dieser Zeit, ist jedoch im 19. Jahrhundert stark übermalt worden.
Jesus betet hier in inniger Hingabe: „Lass diesen Kelch des Leidens an mir vorübergehen, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe.“ In diesen Worten zeigen sich seine menschliche Angst, aber auch zugleich sein unerschütterliches Vertrauen in den Heilsplan Gottes. Der Evangelist Lukas berichtet, dass in diesem Moment ein Engel vom Himmel kam, um Jesus neue Kraft zu geben. Das Altarbild fängt diese bewegende emotionale Szene ein.
Neben dem Seitenaltar befinden sich der heilige Franziskus und der heilige Josef. Informationen hierzu sind wiederum in der zweiten Playlist abrufbar.
Neben dem Ölbergaltar schließt der Kreuzweg Jesu an. Den Leidensweg Jesu finden Sie rechts und links in den Seitenschiffen der Kirche. Die 14 Kreuzwegstationen wurden im Jahre 1856/57 von Andreas Leimgrub aus Würzburg angefertigt. Der Kreuzweg zeigt Jesus auf seinem schweren Weg zur Kreuzigung. Dabei fällt er dreimal unter der Last des Kreuzes. Doch er bekommt auch Hilfe: Simon von Cyrene unterstützt ihn und Maria sowie Veronika stehen ihm bei, geben Trost und Kraft. Beim Beten des Kreuzweges spüren die Gläubigen: Für alle, die leiden, ist Jesus ein Begleiter auf ihrem Weg. Nehmen Sie sich Zeit, den Kreuzweg in aller Ruhe zu betrachten.
Passend zum Kreuzweg finden Sie in den Seitenschiffen auch Gedenktafeln.
Die Kirche hält die Erinnerung an die verstorbenen Marktheidenfelder wach. Im Besonderen wird dabei der Kriegsopfer gedacht.
Im hinteren südlichen (rechten) Seitenschiff ist eine Gedenktafel aus Sandstein für die Gefallenen des deutsch-französischen Krieges 1870 / 71 angebracht.
Weiter vorne finden sich an den Seitenschiffpfeilern zwei Gedenktafeln für die Gefallenen des 1. Weltkrieges von 1914 – 1918.
Im vorderen nördlichen (linken) Seitenschiff sind die Namen der vermissten und gefallenen Soldaten des 2. Weltkrieges von 1939 – 1945 auf den Gedenktafeln zu lesen.
Schauen Sie sich in Ruhe um. Zur Fortsetzung der Führung setzen Sie sich in die letzte Kirchenbank vor der Orgelempore.
In der Kirche befinden sich einige Heiligenfiguren. Exemplarisch stellen wir Ihnen den Patron der Kirche, den heiligen Laurentius, vor. Infos über die anderen Heiligenfiguren der Kirche finden Sie in der zweiten Playlist.
Die Heiligen sind für Katholiken Glaubensvorbilder und werden als Fürsprecher angerufen. Sie werden weltweit verehrt.
Der Heilige Laurentius auf der rechten Mittelschiffseite, ein Werk aus dem 18. Jahrhundert, ist mit Rost und Palmzweig dargestellt. Er war römischer Diakon im 3. Jahrhundert. Papst Sixtus II. soll kurz vor seiner Enthauptung durch Kaiser Valerian das Kirchenvermögen an Laurentius übergeben haben. Dieser verteilte es an die Leidenden und Armen. Auf die Frage des Kaisers nach dem Kirchenvermögen soll er geantwortet haben, die Armen seien das Vermögen der Kirche. Daraufhin ließ Valerian Laurentius auf einem glühenden Rost am 10. August 258 hinrichten.
„Dreht mich um, denn auf der einen Seite bin ich schon durch“ – dieser Ausspruch steht für die Gottergebenheit von Laurentius.
Der Palmzweig in seiner linken Hand zeichnet ihn als Blutszeugen aus, der im Martyrium den triumphalen Preis des ewigen Lebens bei Gott errungen hat.
„Sankt Lorenz kommt in finstrer Nacht ganz sicher mit Sternschnuppenpracht“.
Um den 10. August herum kann man am nächtlichen Himmel zahlreiche Sternschnuppen sehen, auch Tränen des Laurentius genannt.
In der Patriarchalbasilika San Lorenzo fuori le mura, die zu den sieben Pilgerkirchen Roms zählt, finden sich die Reliquien des heiligen Laurentius.
Laurentius ist der Schutzpatron vieler Berufsgruppen, die mit offenem Feuer zu tun haben, wie z.B. der Köche, Bäcker und Bierbrauer.
Die nächste Station unseres Audio-Guides ist die Orgel.
Gehen Sie zum Altarraum und wenden Sie ihren Blick zur Orgel.
Sie blicken auf die Orgel, die sich seit etwa 1750 auf der Empore befindet. Die erste Orgel wurde von dem bedeutenden Orgelbaumeister Johann Conrad Wehr in Marktheidenfeld gebaut und hat sich leider nicht erhalten. Der barocke Orgelprospekt, den Sie sehen, besteht aus zwei großen Harfenfeldern mit zwei Posaunenengeln und wird vor 1730 datiert; seine Herkunft ist unbekannt.
1984 wurde eine neue Orgel mit mechanischer Spieltraktur in den historischen Prospekt von der Orgelbaufirma Elenz aus Veitshöchheim eingebaut. 2009 wurde die Orgel von der Orgelbaufirma Heissler aus Bad Mergentheim generalüberholt, neu intoniert und mit einer modernen Setzeranlage ausgestattet.
Die Orgel mit drei Manualen (Koppelmanual, Hauptwerk, Oberwerk) verfügt über 26 klingende Register und 1757 Pfeifen. Auf der Kartusche über dem Spieltisch steht: „Soli Deo Gloria – Allein Gott die Ehre.“ Der Organist spielt zur größeren Ehre Gottes und zur Freude der Menschen. Die Königin der Instrumente bietet damit für das liturgische, wie auch konzertante Spiel beste Voraussetzungen, verbunden mit einer idealen Akustik in der altehrwürdigen Stadtpfarrkirche St. Laurentius zu Marktheidenfeld.
Zum Abschluss unserer Kirchenführung erklingt unsere Orgel mit der Männerschola, die das Laurentius-Lied singt. Klicken Sie hierzu auf das Video.
Wenn Sie möchten und Ihnen der Audio-Guide gefallen hat, dann unterstützen Sie unsere Arbeit gerne mit einer kleinen Spende im Opferstock. Wir danken Ihnen für ihr Interesse und wünschen Ihnen auf die Fürsprache des Heiligen Laurentius Gottes Segen!
Videos
Orgel: Alexander Wolf
Heilige in der Kirche St. Laurentius
(2. Playlist)
In dieser Führung möchten wir Ihnen einige Heiligenfiguren unserer Kirche näherbringen. Die Heiligen sind für Katholiken Glaubensvorbilder und werden als Fürsprecher angerufen. Sie werden weltweit verehrt.
Unsere Heiligenführung startet unterhalb der Empore. Wenn Sie rechts in Richtung Taufstein blicken, können Sie den Heiligen Kilian entdecken.
Gehen Sie dorthin.
Der heilige Kilian, mit Bischofsstab und Mitra versehen, zählt zusammen mit seinen Gefährten Kolonat und Totnan zu den Frankenaposteln, den Patronenen des Bistums Würzburg.
Er kam im 7. Jahrhundert als iro-schottischer Missionsbischof nach Würzburg und konnte den christlichen Glauben im Frankenland verwurzeln.
Kilian, der die Heirat des Würzburger Herzogs mit der Witwe seines Bruders monierte, wurde daraufhin mit seinen beiden Missionsbrüdern im Jahre 689 ermordet. Die Schädelreliquien von Kilian, Kolonat und Totnan befinden sich im Kiliansschrein der Würzburger Neumünster-Kirche.
Sein Gedenktag wird am 8. Juli gefeiert.
Gegenüber - auch unterhalb der Empore - befindet sich der Heilige Bonifatius, der Apostel der Deutschen.
Er war ein angelsächsischer Mönch, der im 7. und 8. Jahrhundert mit seinem Gefolge als päpstlicher Legat und Missionserzbischof zahlreiche Bistümer, Klöster und Kirchen in Germanien gründete, wie z.B. das nicht weit entfernte Kloster Neustadt am Main. Das kleine Beil in der Bibel erinnert daran, dass Bonifatius eine Eiche, die der germanischen Gottheit Donar gewidmet war, fällte. Aus dem Holz baute er eine Kirche.
Er wurde auf seiner letzten Missionsreise 755 im Friesenland erschlagen. Sein Grab findet sich im Dom zu Fulda. Bonifatius gilt als Schutzpatron Europas. Sein Gedenktag ist der 5. Juni.
In der Nähe des Aufgangs zur Empore steht außerdem eine Figur des Heiligen Antonius von Padua. Er entstammte einer portugiesischen Adelsfamilie und trat im Jahre 1220 in Italien dem Franziskanerorden bei. Er wurde der berühmteste Prediger seiner Zeit und verstand, es die Menschen miteinander zu versöhnen.
„Sankt Antoni sei gepriesen, Schutzpatron der Schlamperliesen".
Eine Legende erzählt, dass ein junger Mitbruder den Psalter von Antonius als Erinnerungsstück hatte mitgehen lassen. Daraufhin hat Antonius so heftig zu Gott gebetet, dass der „Übeltäter“ von so starken Visionen heimgesucht worden ist, dass er das Buch schleunigst zurückgegeben hat.
Von daher rufen die Gläubigen bis heute den heiligen Antonius an, wenn sie etwas verloren oder verlegt haben, um es mit seiner Hilfe wiederzufinden. Zum Dank werfen sie dann eine Münze in den Opferstock. Mit diesem Opferstock verbindet sich auch das Antoniusbrot, d.h. den Armen eine karitative Spende zukommen zu lassen. Eine Mutter, deren Kind auf die Fürsprache des hl. Antonius wieder gesund wurde, schenkte dem Kloster soviel Brot wie das Gewicht ihres Kindes, damit die Franziskanerbrüder die Hungrigen speisen konnten.
Im Kalender ist der 13. Juni als Gedenktag für den Heiligen Antonius eingetragen, der 1231 als Einsiedler starb. Antonius ist Schutzpatron Paduas und Lissabons sowie der Schweinehirten und Reisenden. Er wird bei Unfruchtbarkeit, Fieber und Kriegsnöten angerufen. Ebenso soll er bei der Partnersuche helfen. Zudem soll er zu einer guten Geburt, zum Altwerden, zu einer guten Ernte und zum reichen Pilzfund verhelfen. Er gilt auch als Schutzheiliger der Frauen und Kinder, der Liebenden, der Ehe, der Pferde und Esel. Die Figuren Kilian, Bonifatius und Antonius sind Arbeiten des Würzburger Künstlers Franz-Wilhelm-Driesler, 1890 entstanden.
Am Treppenaufgang zur Orgelempore leuchtet das zweite ovale bunte Glasfenster: Es zeigt Bischof Kilian bei der Missionierung, indem er eine heidnische Familie tauft. Begeben Sie sich nun in das Mittelschiff. Im Folgenden soll es um die Heiligen an den Pfeilern gehen.
Im Mittelschiff folgt als Nächstes links der Heilige Erzengel Michael: Michael führt die himmlischen Heerscharen an und besiegt den Satan, das Böse. Er geleitet die Seelen ins Jenseits und wägt sie ab – dafür stehen Flammenschwert und Waagschale. In den biblischen Büchern Daniel und der Offenbarung wird der Erzengel Michael erwähnt. Er gilt als Schutzpatron Deutschlands. Sein Fest wird am 29. September gefeiert.
Auf der rechten Seite fällt die Figur des Heiligen Sebastian mit den Pfeilen auf: Er war im 3. Jahrhundert römischer Offizier der Prätorianergarde am kaiserlichen Hof. Als er sich öffentlich vor Kaiser Diokletian zu seinem christlichen Glauben bekannte, sollte er mit Pfeilen getötet werden, doch er überlebte und bekannte sich ein zweites Mal vor dem Kaiser zu seinem Glauben, worauf dieser ihn im Zirkus erschlagen ließ.
Die Katakomben-Kirche San Sebastiano an der antiken Via Appia, wo Sebastian begraben ist, gehört zu den sieben Hauptkirchen Roms.
Als Patron der Schützen hat er eine besondere Bedeutung für die Marktheidenfelder Schützenvereine, die Königlich-privilegierte Schützengesellschaft aus dem Jahre 1581 ist der älteste Verein Marktheidenfelds. Im benachbarten Lengfurt gibt es sogar eine Sebastiani-Bruderschaft, die seinen Festtag am 20. Januar in Ehren hält.
Der Heilige Nikolaus schräg gegenüber ist wohl der populärste Heilige. Im 4. Jahrhundert war er Bischof in der türkischen Hafenstadt Myra. Viele Legenden haben zu seiner Beliebtheit beigetragen:
Der Anker steht für seine Rettung einiger in Seenot geratener Seefahrer und für das Kornwunder: Während einer großen Hungersnot lag ein kaiserliches Getreideschiff im Hafen von Myra. Bischof Nikolaus konnte die Besatzung überzeugen, einige Kornsäcke zu spenden. Als die Ladung dem Kaiser von Byzanz übergeben wurde, fehlte kein einziger Kornsack.
Das Schwert erinnert daran, wie Nikolaus drei unschuldig verurteilte Männer vom Tode bewahrte, indem er dem Scharfrichter das Schwert entriss.
Die drei goldenen Kugeln erzählen davon, wie Bischof Nikolaus drei verarmte Töchter vor der Prostitution bewahrte, indem er die Goldklumpen heimlich durchs Fenster warf. Mit dieser Mitgift konnte der Vater seine drei Töchter verheiraten.
Das Buch weist auf seine Teilnahme an der ersten großen Kirchenversammlung, dem ökumenischen Konzil von Nicäa im Jahre 325 hin, wo er seinem theologischen Gegner, Bischof Arius, eine heilige Ohrfeige verpasste, da dieser die wahre Göttlichkeit Jesu leugnete.
Früher fand die Bescherung nicht an Weihnachten, sondern am Nikolaustag statt, also am 6. Dezember. Der heilige Nikolaus wird auch in der orthodoxen Kirche sehr verehrt, vor allem in Russland. Er ist Patron der Marktheidenfelder Fischer- und Schifferzunft, die 1649 gegründet wurde. Darüber hinaus gilt er als Schutzheiliger von Berufen wie Kaufmann, Rechtsanwalt, Apotheker, Metzger und Bäcker, von Getreidehändlern, Dreschern, Pfandleihern, Juristen, Schneidern, Küfern, Fuhrleuten und Salzsiedern. Nikolaus ist Patron der Schüler und Studenten, Pilger und Reisenden, Liebenden und Gebärenden, der Alten, Ministranten und Kinder und auch von Dieben, Gefängniswärtern, Prostituierten und Gefangenen.
Der Heilige Laurentius auf der rechten Mittelschiffseite ist mit Rost und Palmzweig dargestellt. Er war römischer Diakon im 3. Jahrhundert. Papst Sixtus II. soll kurz vor seiner Enthauptung durch Kaiser Valerian das Kirchenvermögen an Laurentius übergeben haben. Dieser verteilte es an die Leidenden und Armen. Auf die Frage des Kaisers nach dem Kirchenvermögen soll er geantwortet haben, die Armen seien das Vermögen der Kirche. Daraufhin ließ Valerian Laurentius auf einem glühenden Rost am 10. August 258 hinrichten.
„Dreht mich um, denn auf der einen Seite bin ich schon durch“ – dieser Ausspruch steht für die Gottergebenheit von Laurentius.
Der Palmzweig in seiner linken Hand zeichnet ihn als Blutszeugen aus, der im Martyrium den triumphalen Preis des ewigen Lebens bei Gott errungen hat.
Um den 10. August herum kann man am nächtlichen Himmel zahlreiche Sternschnuppen sehen, auch Tränen des Laurentius genannt.
In der Patriarchalbasilika San Lorenzo fuori le mura, die zu den sieben Pilgerkirchen Roms zählt, finden sich die Reliquien des heiligen Laurentius.
Laurentius ist der Schutzpatron vieler Berufsgruppen, die mit offenem Feuer zu tun haben, wie z.B. der Köche, Bäcker und Bierbrauer.
Die Heiligenfiguren Michael, Sebastian, Nikolaus und Laurentius sind Werke aus dem 18. Jahrhundert.
Jetzt schauen wir uns die Heiligen an den Seitenaltären an. Gehen Sie zuerst zum Marienaltar auf der rechten Seite.
Die heilige Barbara rechts oben zählt zu den 14 Nothelfern. Sie lebte im 3. Jahrhundert in der Türkei. Als christliche Jungfrau wurde sie von ihrem Vater in einem Turm gefangen gehalten. Dort ließ sie ein drittes Fenster ausbrechen als Hoffnungszeichen für die Heilige Dreifaltigkeit. Kelch und Hostie in ihrer Hand stehen für ihren Glauben an Jesus Christus; das Schwert weist auf ihren Märtyrertod durch ihren Vater hin.
Ihr Gedenktag ist der 4. Dezember, an dem es Brauch ist, Obstzweige zu schneiden und in eine Vase mit Wasser zu stellen, damit sie zu Weihnachten blühen. Barbara ist Patronin der Bergleute, der Artillerie und gegen Blitzschlag.
Links gegenüber findet sich die Figur des heiligen Wendelin mit einem Schaf. Aus dem iro-schottischen Königssohn wurde im 6. Jahrhundert ein Schafhirte und Einsiedler in Trier. Später wurde er Abt im Kloster Tholey.
Sein Gedenktag ist der 21. Oktober. Wendelin wird als Schutzpatron der Hirten und Bauern verehrt und als Fürsprecher guter Ernten sowie gegen Viehseuchen angerufen, wie folgende Bauernregel belegt: „St. Wendelin, verlass' uns nie, schirm' unsern Stall, schütz' unser Vieh!“
In einer verglasten Nische darunter sehen Sie einen typischen Jesusknaben dargestellt, der zu Prozessionen der damaligen Kindheit-Jesu-Vereine mitgetragen wurde. Die Heiligenfiguren am Marienaltar stammen aus der Werkstatt der Gebrüder Schiestl aus Würzburg, gegen Ende des 19. Jahrhunderts.
Gehen Sie jetzt zum linken Seitenaltar, der Jesus am Ölberg zeigt.
Auf der linken Konsole ist die Holzfigur des Heiligen Franz von Assisi angebracht. Franz wird 1181 in eine wohlhabende italienische Kaufmannsfamilie hineingeboren. Sein Ziel, ein edler Ritter zu werden, gibt er nach einem verlorenen Krieg und einjähriger Kerkerhaft auf. Als ihm der gekreuzigte Herr den Auftrag gibt „Franziskus, geh und baue mein Haus wieder auf“, gründet er den franziskanischen Bettelorden. Er lebt in Armut und kümmert sich um die Armen. Wenige Wochen vor seinem Tod trägt er die Stigmata, die Wundmale Jesu, was er als große Ehre empfindet. Er stirbt 1226 in seiner Heimat. Sein Sonnengesang ist ein Vermächtnis für eine friedliche Koexistenz von Mensch, Tier und Natur.
Franziskus hat in Greccio das erste Mal das Weihnachtsevangelium in Form einer lebenden Krippe darstellen lassen. Die Orden der Franziskanerinnen und Franziskaner wandeln bis heute auf seinen Spuren.
Sein Gedenktag ist der 4. Oktober. Franziskus ist der Patron Italiens und der Schutzpatron aller Tiere.
Auf der rechten Konsole sehen wir die Figur der Maria, ganz schlicht gearbeitet. Eine einfache Frau aus dem Volk wird von Gott zur Mutter Jesu erwählt. Außerdem ist der Heilige Josef hier gleich zweimal zu sehen: Rechts in der verglasten Nische mit einer Lilie und dem Jesuskind mit offenen Armen.
Die Lilie steht für die Reinheit und Gerechtigkeit Josefs. Jesus' offene arme symbolisieren bedingungslose Liebe: Er lädt alle Menschen ein, zu ihm zu kommen. Das zweite Mal ist Josef am Pfeiler zu sehen, wo das Jesuskind eine Weltkugel in der Hand hält. Die Weltkugel symbolisiert Jesus als Herrscher und Erlöser der Welt.
In der Bibel erfahren wir sehr wenig über Josef, nur im Matthäus- und Lukasevangelium. Er war Zimmermann, mit Maria verheiratet und der Ziehvater von Jesus. Er lebte und arbeitete mit seiner Familie in Nazareth.
Josef gilt seit alters her als Patron für eine gute Sterbestunde.
Die Heiligenfiguren am Ölbergaltar sind ebenfalls Ende des 19. Jahrhunderts von den Würzburger Gebrüdern Schiestl in Handarbeit gefertigt worden.
Sie merken: Die Heiligenfiguren haben für die Gläubigen eine tiefgehende Bedeutung. Sie sind nicht nur kunstvolle Darstellungen, sondern auch Ausdruck von Hoffnung, Trost und Vorbildern im Glauben. Wie der Kirchenvater Ambrosius einmal sagte: „Nicht der Stein wird verehrt, sondern der Heilige, den er darstellt.“
In diesem Sinne laden die Heiligenfiguren dazu ein, sich mit dem eigenen Glauben auseinanderzusetzen und Inspiration aus den Lebensgeschichten der Heiligen zu schöpfen. Wir hoffen, dass wir dazu anregen konnten.